Sachsen droht Wettbewerbsnachteil bei Erneuerbaren
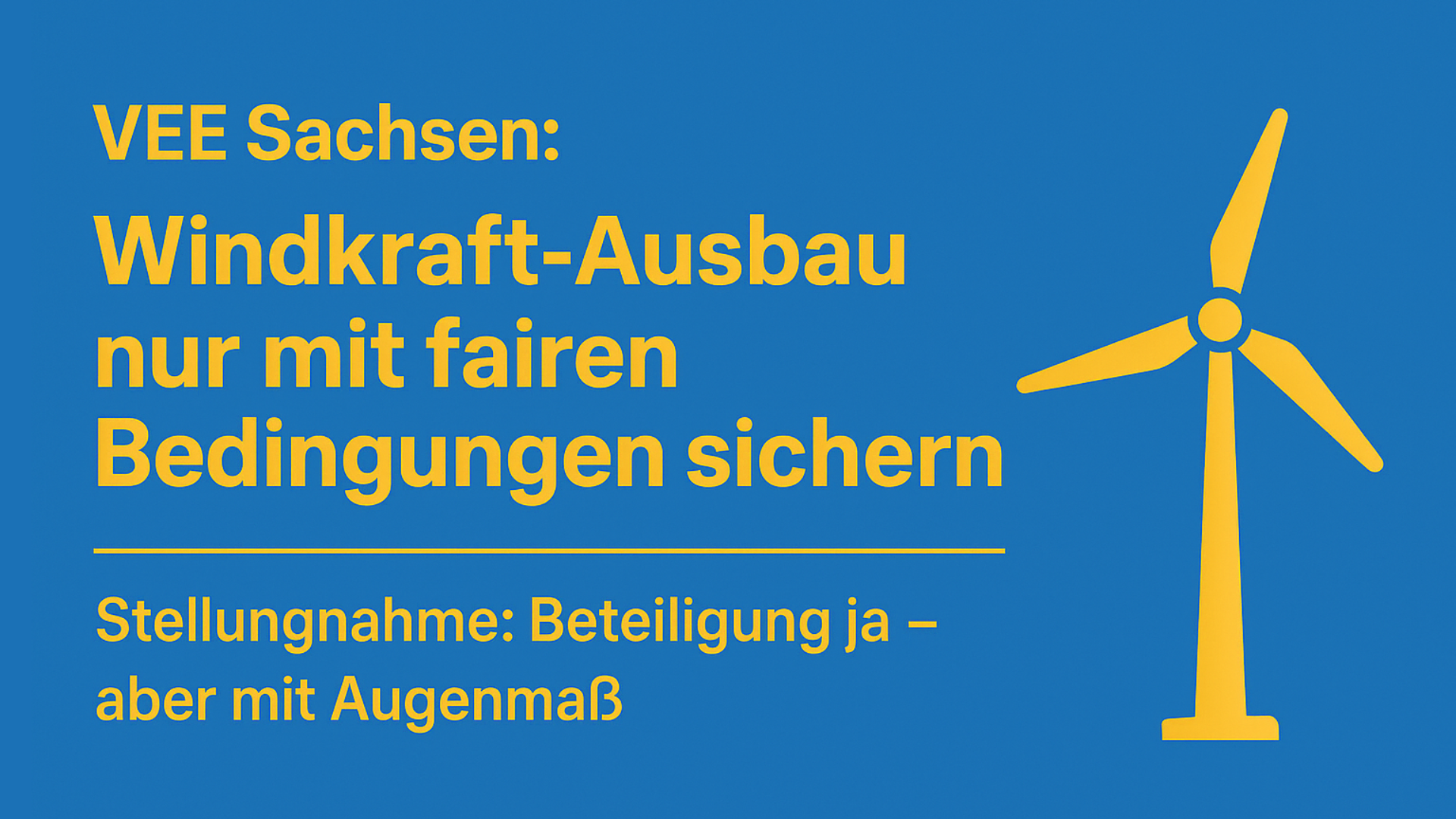
Stellungnahme zum Änderungsantrag der Fraktionen CDU, SPD und BSW zum Ge-setzentwurf der Fraktionen CDU und SPD, Drs 8/2644 „Gesetz zur Änderung pla-nungsrechtlicher Vorschriften und akzeptanzfördernder Maßnahmen im Bereich der Erneuerbaren Energien“ - Drucksache 8/2644 (Stand: 25. August 2025)
Den Wunsch des Gesetzgebers zur Steigerung von Akzeptanz und lokaler Wertschöpfung durch finanzielle Beteiligung von Standortgemeinde(n) am Ausbau der Wind- und Solarenergie vor Ort erkennen wir ausdrücklich an. Dabei darf das Gesetzesvorhaben (Drucksache 8/2644, Stand 25.8.2025) aber die Balance aus Investitions- und Vertrauensschutz, der erforderlichen Wirtschaftlichkeit und einer angemessenen Beteiligungshöhe und den Ausbauzielen für Erneuerbare Energien nicht aus den Augen verlieren.
Eingriff in die Berufsfreiheit
Eine mögliche Zahlungshöhe von 0,5 Cent je Kilowattstunde stellt einen Eingriff in das Grundrecht des Artikel 12 Abs. 1 Grundgesetz und in die Berufsfreiheit dar und ist in dieser Form auch gegenüber dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes mit Beschluss vom 23. März 2022 (BVerfG, Beschl. V. 23.03.2022, 1 BvR 1187/17 – juris) nicht verhältnismäßig, zumal er keinerlei Begründung für die genannten Zahlungen liefert.
Wettbewerbsverzerrungen der bundesweiten EEG-Ausschreibungen
Die Vergabe von Zuschlägen für WEA nach § 36 EEG und die Ermittlung der Vergütung für Windenergieprojekte erfolgt seit dem Jahr 2017 in einem bundesweiten Ausschreibungsverfahren und somit im Wettbewerb. Dabei können nur die Projekte mit dem niedrigsten EEG-Zuschlagswert umgesetzt werden – unabhängig vom Standort. Standorte in Sachsen stehen damit im direkten Preiswettbewerb mit allen anderen Bundesländern. Dabei richtet sich die unternehmerische Entscheidung in erster Linie nach der wirtschaftlichen Belastbarkeit eines Projekts über seine Realisierbarkeit, nicht die Klimabilanz oder Akzeptanzwirkung des Projektes vor Ort. Daran ändert auch die Höhe des Höchstwerts in den EEG-Ausschreibungen nichts. Um so wichtiger wäre daher ein bundesweit einheitliches Level-Playing-Field mit identischen Wettbewerbsbedingungen und Beteiligungsabgaben. Mit dem Gesetz werden die Wettbewerbsbedingungen in Sachsen verzerrt.
Anreiz zum Abschluss von Individualvereinbarungen werden genommen
Vorhabenträger haben keinerlei Anreiz mehr zum Abschluss einer, zumal mit höherem bürokratischem Aufwand verbundenen, Individualvereinbarung. Kommunen werden immer die höhere Direktzahlung einfordern, statt zugunsten eines bestimmten Beteiligungsmodells auf Zahlungen zu verzichten. Die ursprüngliche Idee einer akzeptanzschaffenden Vereinbarung, bei der sich Kommunen und Vorhabenträger gütlich einigen, wird ab absurdum geführt. Die Akzeptanz der Energiewende gefährdet.
Anpassung von § 5 Individualvereinbarung auf 0,4 ct/kWh zwingend notwendig
Wir plädieren daher auf eine Deckelung der Beteiligungssumme im Rahmen der Individualvereinbarung auf 0,4 ct/kWh. Denn so können sich Vorhabenträger und Gemeinde gleichermaßen finanziell gegenüber der Zahlungsverpflichtung optimieren und im Sinne des Gesetzes zusammenfinden.
Stellungnahme
Den Wunsch des Gesetzgebers zur Steigerung von Akzeptanz und lokaler Wertschöpfung durch finanzielle Beteiligung von Standortgemeinde(n) am Ausbau der Wind- und Solarenergie vor Ort erkennen wir ausdrücklich an. Dabei darf das Gesetzesvorhaben (Drucksache 8/2644, Stand 25.8.2025) aber die Balance aus Investitions- und Vertrauensschutz, der erforderlichen Wirtschaftlichkeit und einer angemessenen Beteiligungshöhe und den Ausbauzielen für Erneuerbare Energien nicht aus den Augen verlieren.
Worum geht es?
Der rasche und zielgerichtete Ausbau von Windenergie ist eine direkte Investition in die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft Sachsen. Die Landesregierung hat dieser Notwendigkeit über die Flächenausweisung gemäß Windenergieflächenbedarfsgesetzes Rechnung getragen.
Um die Akzeptanz für diesen Ausbau weiter hochzuhalten, beabsichtigt die Landesregierung die finanzielle Beteiligung der Standortkommunen (Drs. 8/2644) zu erhöhen. Das unterstützen wir. Auch die Höhe der Zahlungsverpflichtung i.H.v. 0,3 ct pro Kilowattstunde im Windbereich. Vorhabenträger müssen aber die Möglichkeit haben, diese zusätzliche Projektbelastung im Rahmen der Individualvereinbarung reduzieren zu können. Andernfalls drohen unwirtschaftliche Projekte und folglich die Nichtrealisierung künftiger und für die Zielerreichung notwendiger Vorhaben.
Die Kostenoptimierung des Vorhabenträgers kann aber nur über die Anwendung von § 6 EEG gelingen und die damit verbundene Rückerstattung von 0,2 ct/kWh. Dies setzt die Einigung mit der Standortkommune voraus. Andernfalls erfolgt der Rückfall auf die nicht erstattungsfähige Zahlungsverpflichtung des § 4 (0,3 ct/kWh). Im Gegensatz zum Vorhabenträger können Kommunen sich gegenüber der Zahlungsverpflichtung nur optimieren. Folglich fehlt jeder Anreiz für die Kommunen an einer Individualvereinbarung. Denn auch im Falle einer Nichteinigung bekäme sie die garantierte Zahlungsverpflichtung gemäß § 4. Die finanziellen Folgen und das wirtschaftliche Risiko liegen somit ausschließlich beim Vorhabenträger!
Marktteilnehmer in Sachsen würden gegenüber denen in anderen Bundesländern in den bundesweiten EEG-Ausschreibungen benachteiligt. Der gerade erst durch die Zunahme der Anzahl der Genehmigungen entfachte Wettbewerb würde zwangsläufig
massiv abgebremst. Der aktuelle Trend, der zu einem Absinken der Strompreise für Verbraucher und Industrie führt, würde ausgebremst. Dabei sanken die EEG-Zuschlagswerte zuletzt.
Die wirtschaftliche Win-Win-Situation für Kommunen und Vorhabenträger wäre die Deckelung der Beteiligungshöhe der Individualvereinbarung bei 0,4 ct/kWh: Kommunen können sich so gegenüber der Zahlungsverpflichtung um 0,1 ct/kWh besserstellen, Vorhabenträger ihre Zahlungslast um § 6 EEG reduzieren. Beide Vertragsparteien hätten ein gemeinsames Interesse am Abschluss einer Individualvereinbarung.
Was ist zu tun?
Die im Änderungsantrag vorgesehene maximale Beteiligungshöhe von 0,5 ct/kWh (§ 5 Absatz 1) konterkariert den Anreiz zur Einigung zwischen Vorhabenträger und Kommune. Denn selbst im Falle der Einigung mit der Kommune beim Maximalwert und dem finanziellen Optimieren des Vorhabenträgers über die Erstattungsmöglichkeit des § 6 EEG, würde dieser immer mit 0,3 ct/kWh belastet. Die eigentliche Win-Win-Situation wäre eine maximale Beteiligungshöhe von 0,4 ct/kWh über die Individualvereinbarung. In diesem Fall bekäme die Kommune mehr als die Zahlungsverpflichtung in Höhe von 0,3 ct/kWh (§ 3), der Vorhabenträger könnte seine Zahlung aber auf 0,2 ct / kWh (Anwendung § 6 EEG) reduzieren. Der Änderungsantrag sollte dahingehend zwingend angepasst werden, um den Anreiz sowohl für die Kommunen zum Abschluss einer Individualvereinbarung zu erhalten als auch für die Vorhabenträger, die Zahlung auf ein wirtschaftliches Maß zu reduzieren. Andernfalls hätte Sachsen die bundesweit höchste Beteiligungsabgabe mit der Konsequenz eines künftigen Einbruchs beim Windenergieausbau. Das deutlich windstärkere Mecklenburg-Vorpommern diskutiert daher aktuell auch wegen erheblicher verfassungswidriger Bedenken über eine Reduzierung der Zahlungsverpflichtung auf 0,4 ct/kWh unter Anwendung von § 6 EEG.
Die Zahlungshöhe stellt er einen Eingriff in das Grundrecht des Artikel 12 Abs. 1 Grundgesetz und in die Berufsfreiheit dar und ist in dieser Form auch gegenüber dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes mit Beschluss vom 23. März 2022 (BVerfG, Beschl. V. 23.03.2022, 1 BvR 1187/17 – juris) nicht verhältnismäßig, zumal er keinerlei Begründung für die genannten Zahlungen liefert.
Die Regelung zur Zahlungshöhe muss sich daher in der Höhe an der bundesrechtlichen Regelung orientieren. Die Festlegung muss so erfolgen, dass die Förderung des Ausbaus der Windenergie durch das Gesetz erreicht wird, und zwar bundesweit einheitlich, eine Benachteiligung der Wirtschaft in Sachsen zu verhindern. Die Zahlungen sollten sich demnach auf 0,3 ct/kWh für Wind beschränken, wovon 0,2 ct/kWh nach § 6 EEG zwingen anrechenbar sein sollten.
Formulierungsvorschlag
§ 5 Individualvereinbarung
(2) Der Betreiber kann mit jeder nach § 3 anspruchsberechtigten Gemeinde anstelle der
kalenderjährlichen Zahlung nach § 4 Absatz 2 ein anderes Beteiligungsmodell schriftlich
vereinbaren, dessen wirtschaftlicher Wert in einem angemessenen Verhältnis zum
Wert der Zahlungsverpflichtungen gemäß § 4 Absatz 2 stehen muss. Eine Vereinbarung
ist insbesondere dann angemessen, wenn deren wirtschaftlicher Wert zum Zeitpunkt
des Abschlusses der Vereinbarung zwischen dem halben Wert der Zahlungsverpflich-
tung nach § 4 und einem Wert in Höhe von 0,4 Cent pro Kilowattstunde für die tatsäch-
lich eingespeiste Strommenge liegt.
Links:
- VEE-Positionspapier zur Drucksache 8/2644 vom 27.08.2025
- Sächsische.de vom 03.09.2025 - Gemeinden in Sachsen sollen mehr Geld durch Windräder erhalten
dazu auch: